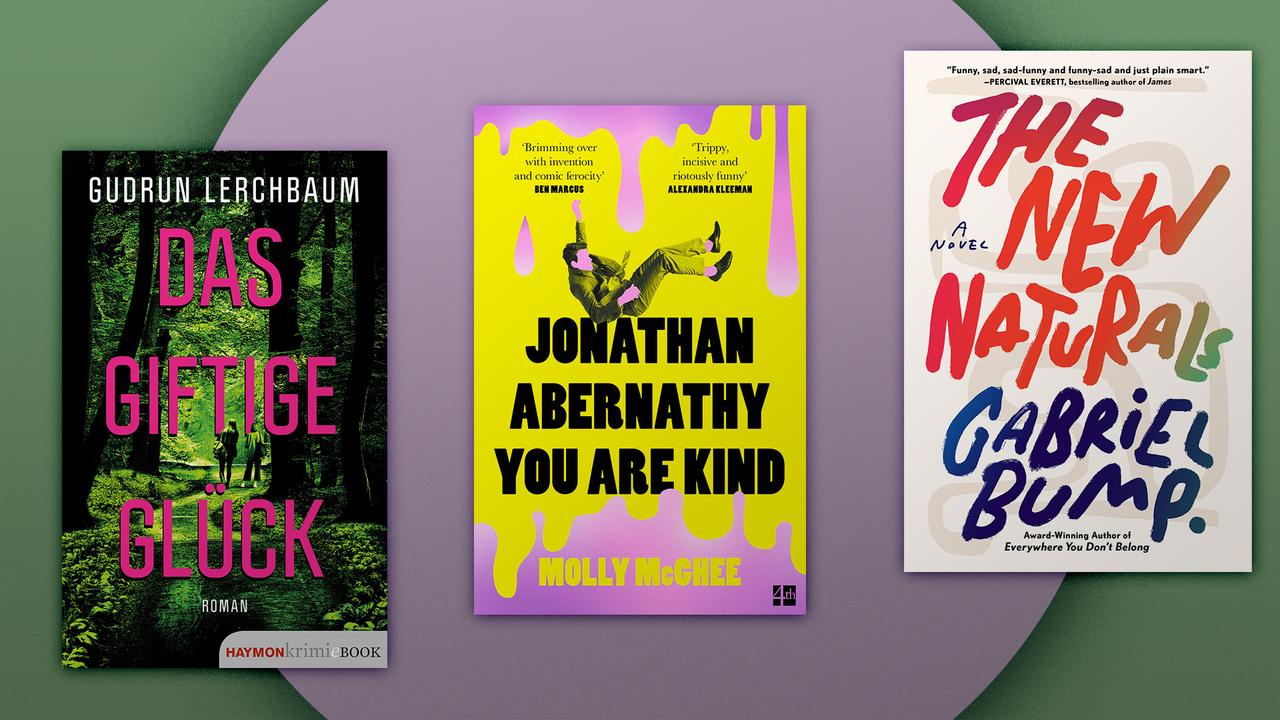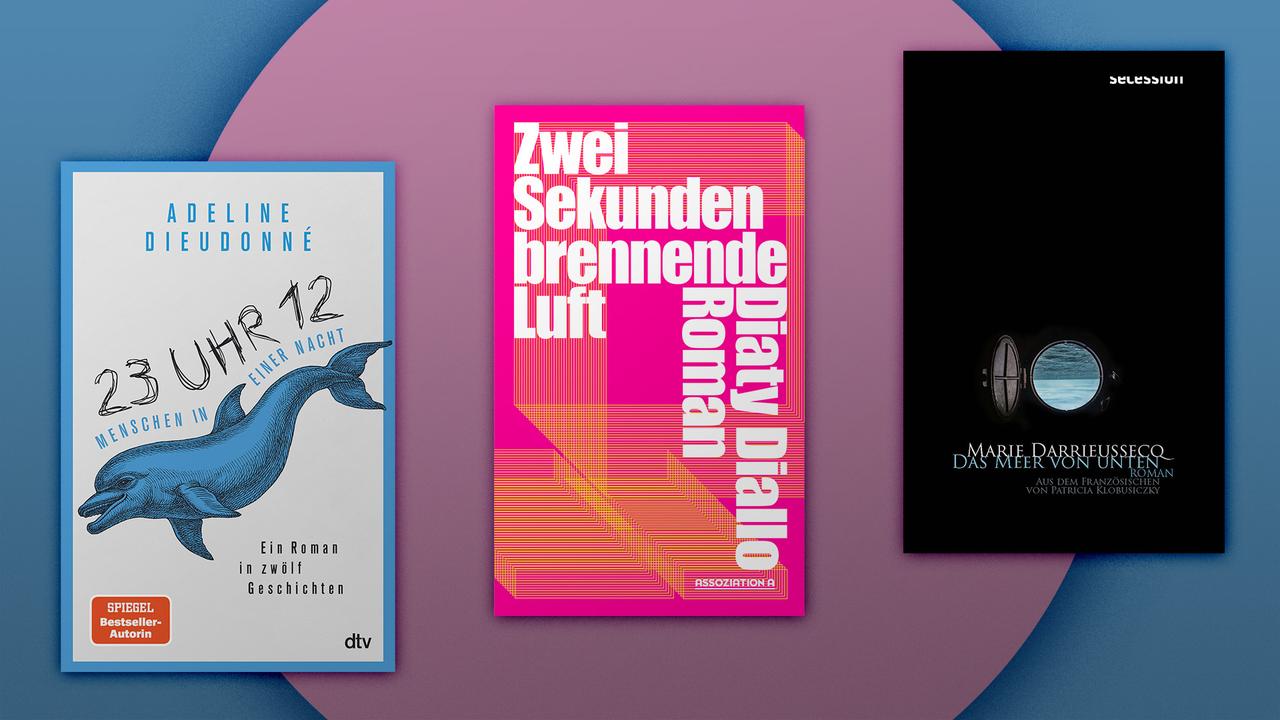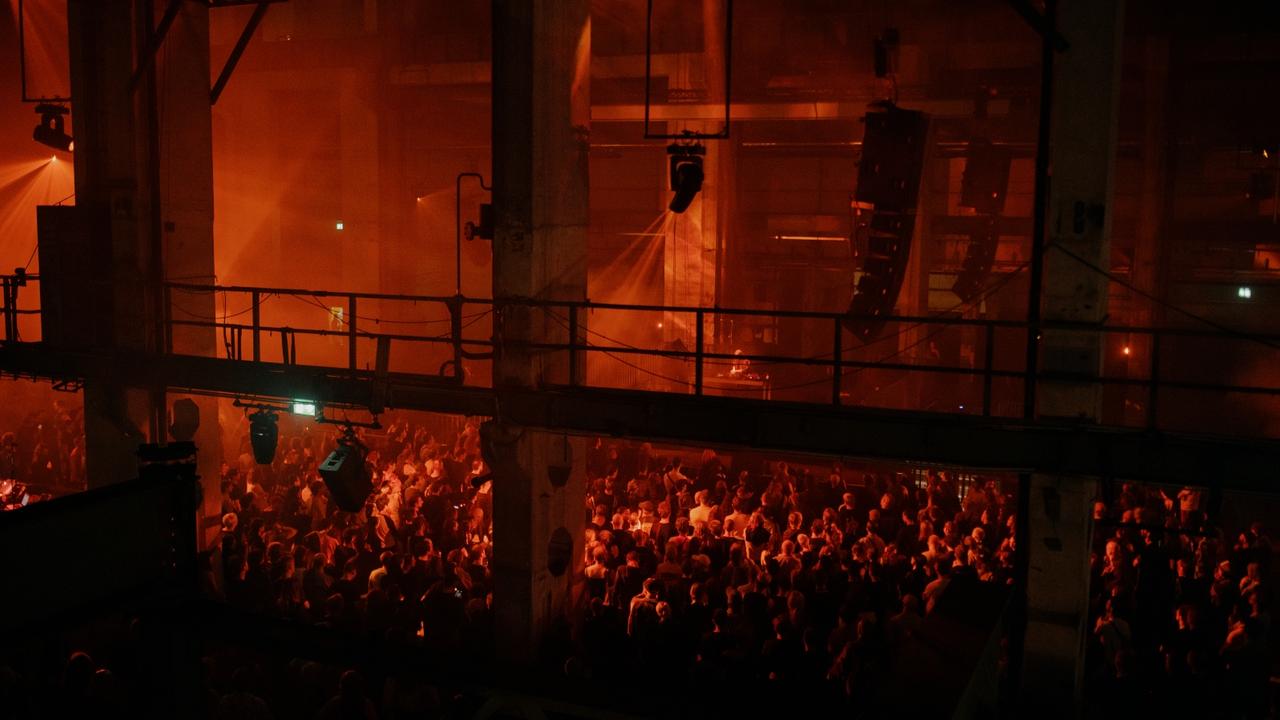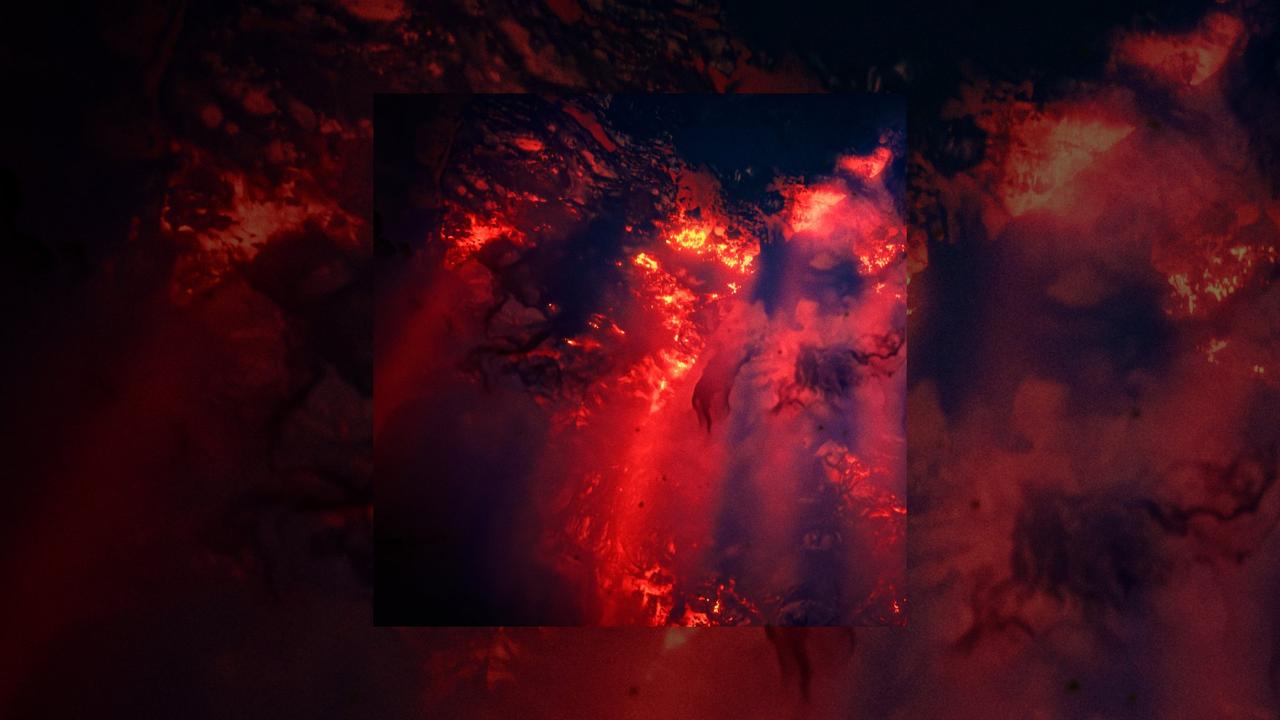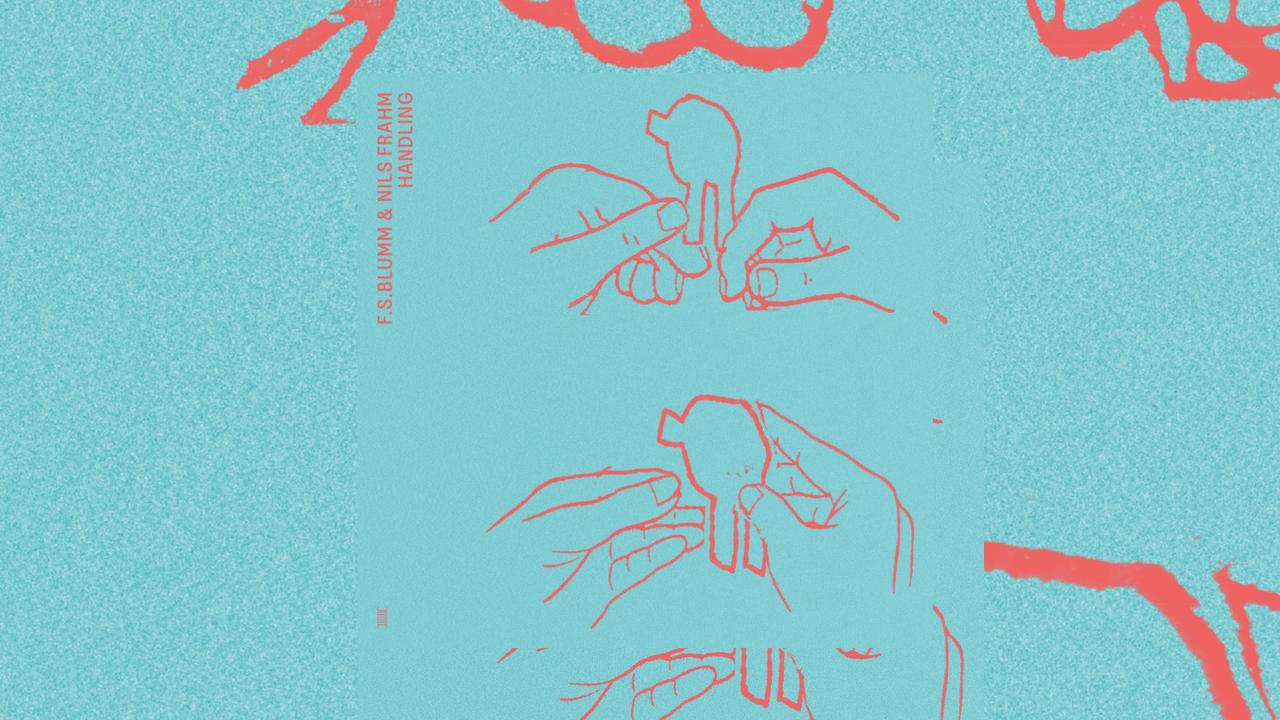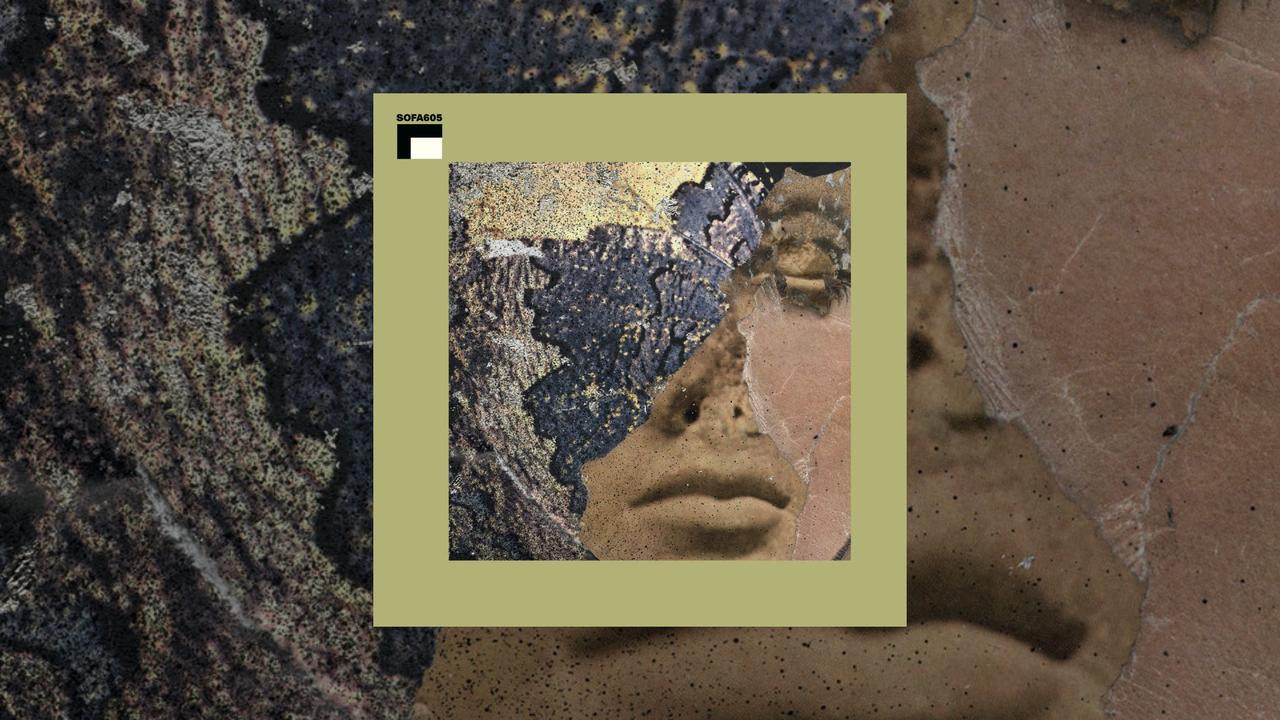Pageturner – Oktober 2025: BlickeLiteratur von Esther Kinsky, Olivia Laing und Hans von Trotha
1.10.2025 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute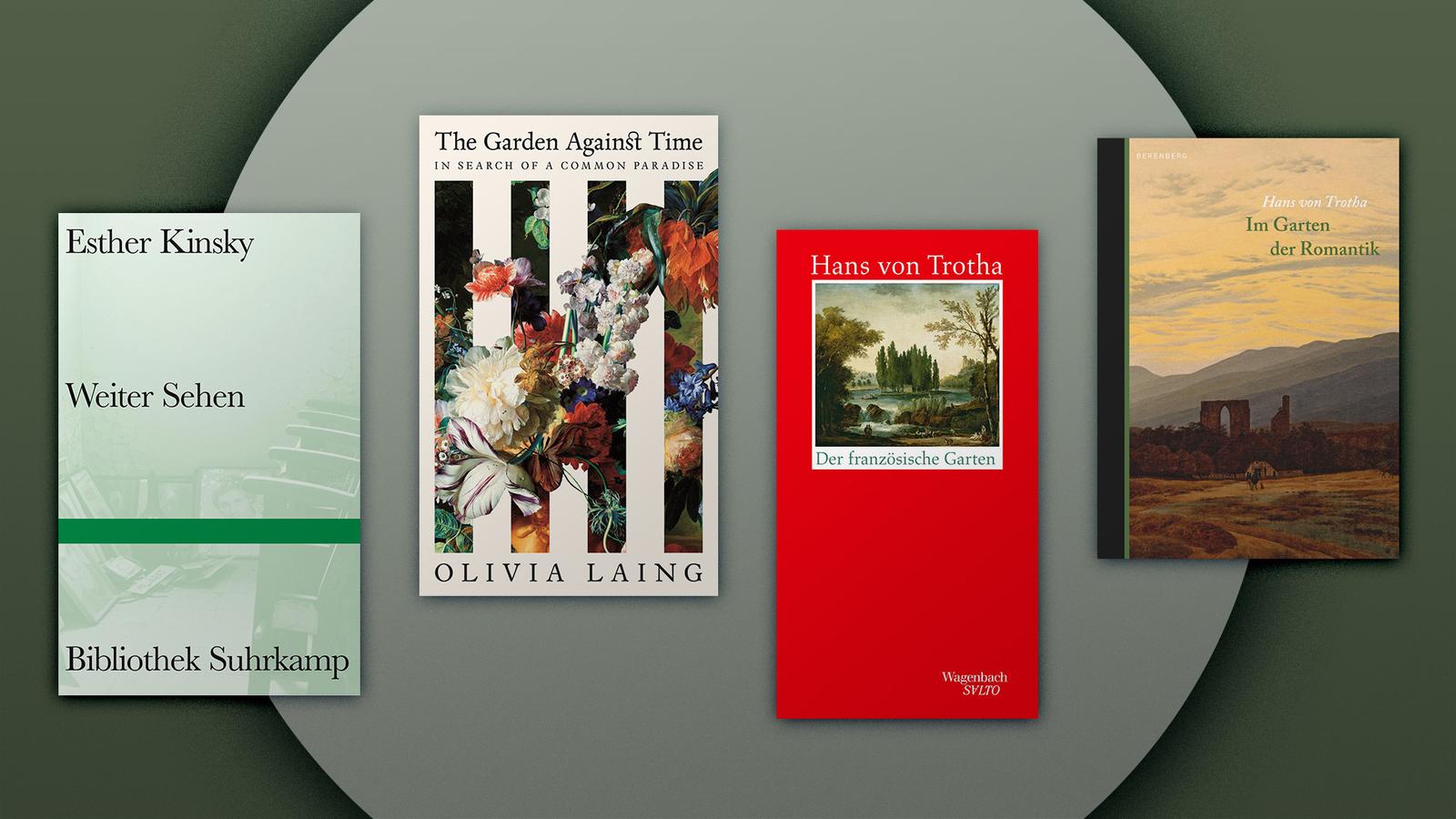
Kino als sozialer Raum, ein Haus auf dem Land und die Gärten der Welt. Zu Beginn des Herbstes sammelt Frank Eckert literarische Strahlkraft.
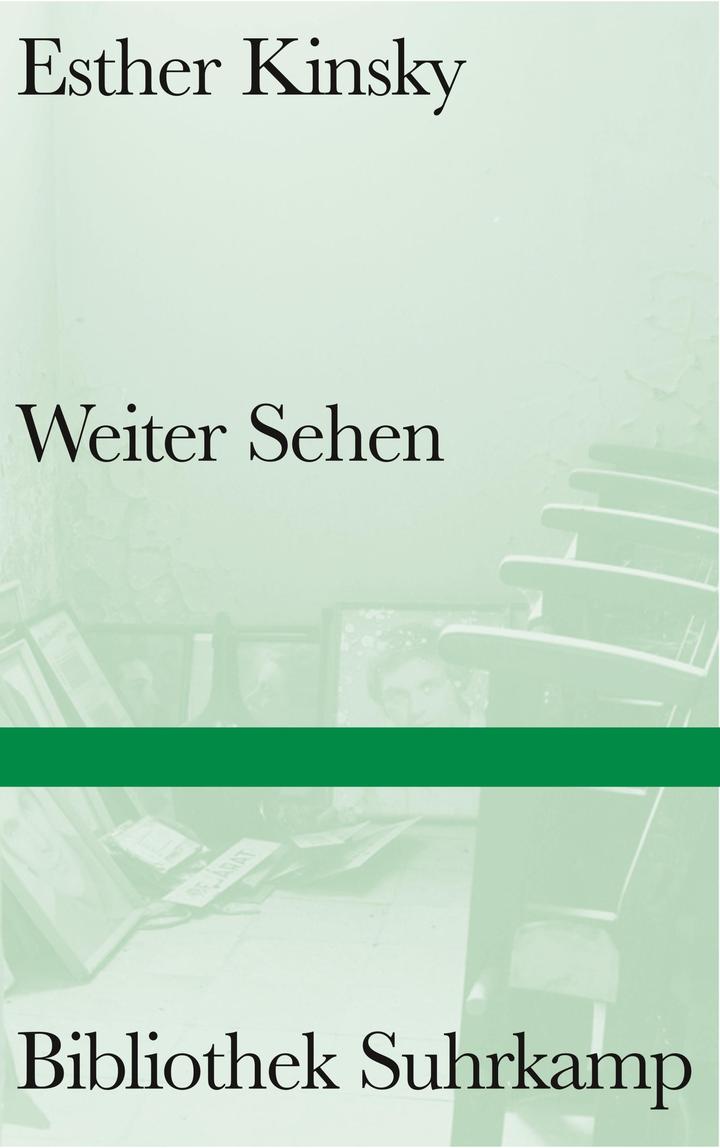
Weiter Sehen (Affiliate-Link)
Esther Kinsky – Weiter Sehen (Suhrkamp, 2023)
Kino ist ja auch nur Leben. Und, möchte ich mit Esther Kinskys jüngstem Roman hinzufügen, tiefste Melancholie. Dazu noch Indiz einer allgemeineren soziokulturellen Entwicklung hin zur Nahsicht, zu Details, zum Privaten, Individuellen, Abgekapselten, Kleinen und Isolierten, das uns so vieler menschlicher Möglichkeiten beraubt. Waren Kinskys bisherige Romane schon autofiktionale Psychogeografien, miterlebte Erzählungen von Begegnungen mit Orten und Menschen, so rückt „Weiter Sehen“ noch näher an das Erfahrene heran, vermittelt über die Distanz des Kinos.
Der Roman entfaltet sich dieses Mal nicht im milchigen Licht Norditaliens, zuletzt im Schwemmland des Po oder in der zerklüfteten Karstlandschaft der Berge, sondern im Grenzland von Ungarn und Rumänien, wo das Land so platt ist, „man braucht nur auf einen Kürbis steigen und könne bis Budapest sehen“. Die namenlose Ich-Erzählerin reflektiert darin über das Sehen, das weiter Sehen, wie es ein Jahrhundert lang das Kino ermöglichte. Eine gemeinschaftliche und doch individuelle Erfahrung, die heute zunehmend verloren geht. Am Rand der flachen Welt ist es schon längst so weit, das „Mozi“ seit vielen Jahren geschlossen, die Sozialgemeinschaft im Dorf, das einmal eine Stadt war, verfallen und verwittert wie die Häuser und Straßen, die im dauerfeuchten Boden ziemlich unpittoresk in sich zusammenfallen. Der Versuch der Wiederbelebung von Kino und Sozialleben durch die Erzählerin ist von Beginn an – im Wissen um das zwangsläufige Scheitern – melancholisch, aber nicht tragisch. Nicht einmal melodramatisch. Die Verbindlichkeit der Kino-Erfahrung und damit dessen Gemeinschaft und Identität stiftender Wert ist den wenigen verbliebenden Dorfbewohnern noch in lebhafter Erinnerung. Dennoch muss die Wiederbelebung an Desinteresse und ökonomischem Kalkül scheitern. Es bleibt ein kurzer wie schöner Moment der Hoffnung, bevor die Realität wieder die Übermacht gewinnt. Vielleicht ja eine Metapher für das Kino selbst, eine von unzähligen in dieser – wie von Kinsky nicht anders gewohnt – wundervoll und sprachmächtig erzählten „wahren“ Geschichte.

The Garden Against Time (Affiliate-Link)
Olivia Laing – The Garden Against Time (Picador, 2024)
Im Laufe der Jahre habe ich gelernt und akzeptiert, dass mir (und meinem Rücken und meinen Allergien) die Reflexion über Gärten und Gärtnern wesentlich besser bekommt als die Praxis vor Ort. Wenn eine solche Gartenaufarbeitung dann noch von Olivia Laing kommt: umso besser. „The Garden Against Time“ ist dann auch nur zu einem kleinen Teil Chronik ihres späten Familienglücks:Heiraten, nach Suffolk aufs Land ziehen, dort ein Anwesen mit einem (lokal) berühmten historischen Garten aus der Zeit King Georges erwerben und restaurieren.
Interessanter als die Aufzählung aller sprießenden und wuchernden Flora sind allerdings die Geschichten ihrer teils illustren und prominenten gartenverantwortlichen Vorgänger:innen und noch mehr sogar die breiter angelegte Historie und Genese der Gartenkunst selbst. Speziell der südbritischen, die immer mit Klasse und Repräsentation, Macht, Einfluss und Emanzipation, häufig auch mit dem Kolonialismus des British Empire und nicht zuletzt mit Reichtum aus dem Sklavenhandel zu tun hatte. Aber darüber hinaus zieht Laing Verbindungen mit dem Prozess der Zivilisation selbst, mit der seit der Antike quer durch Kulturen und Zeiten vorhandenen Assoziation von Gärten mit dem Paradies. Das Paradox, dass die oft mit immensem landschaftsarchitektonischen Aufwand betriebene Einschließung eines Stücks Natur, die Abtrennung eines Teils der Natur von der umgebenden Wildnis, zur Idylle werden kann, zu einem sorgfältig kuratierten Gleichgewicht zwischen botanischer Anarchie und Ordnung – mit jeweils riesigem permanenten Pflegeaufwand. Sogar Olivia Laing, die kluge Chronistin urbaner Einsamkeit, neigt hin und wieder zur Verklärung des Landlebens als ultimativ ästhetisiertes Cottage-mit-riesigem-Garten-Dasein in einer von der feindlichen Umwelt abgewandten Enklave der Selbst- und Gartenverwirklichung. Vorbilder sind zum Beispiel Derek Jarman und einige queere und/oder kommunal-libertinäre Gartenenthusiasten der vergangenen Jahrhunderte. Laing ist allerdings klug genug, dies nicht als Insta-Lebensmodell für alle zu verkaufen und blendet die oft schwierige Historie und das meist blutige Erbe alter Gärten zum Glück nicht aus.
Hans von Trotha – Im Garten der Romantik (Berenberg, 2016) / Der Französische Garten (Verlag Klaus Wagenbach, 2022)
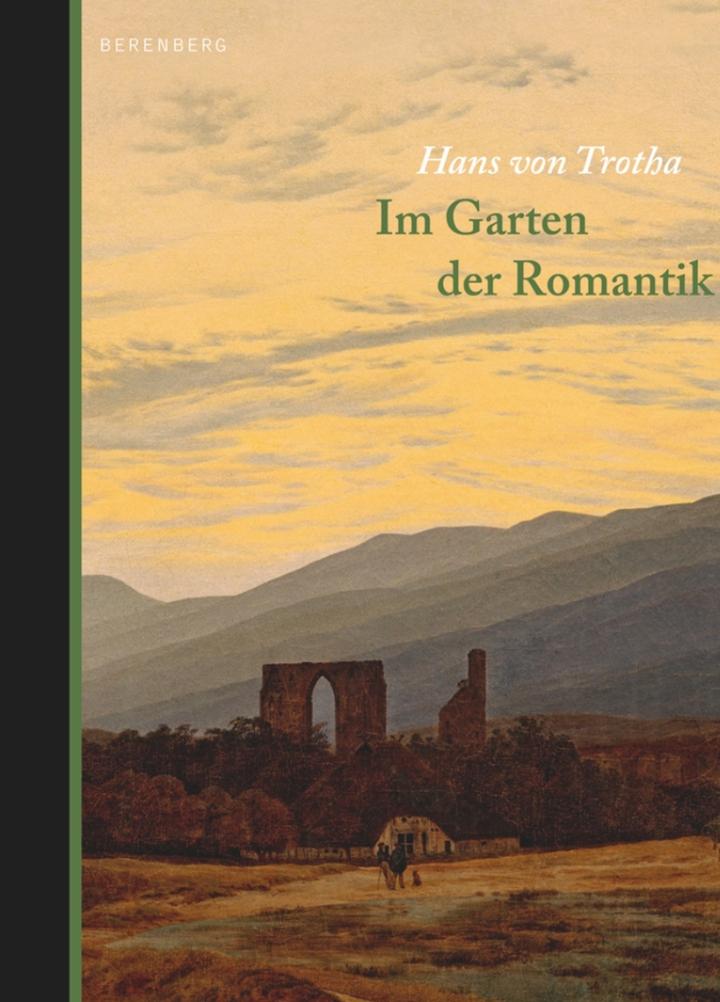
Im Garten der Romantik (Affiliate-Link)
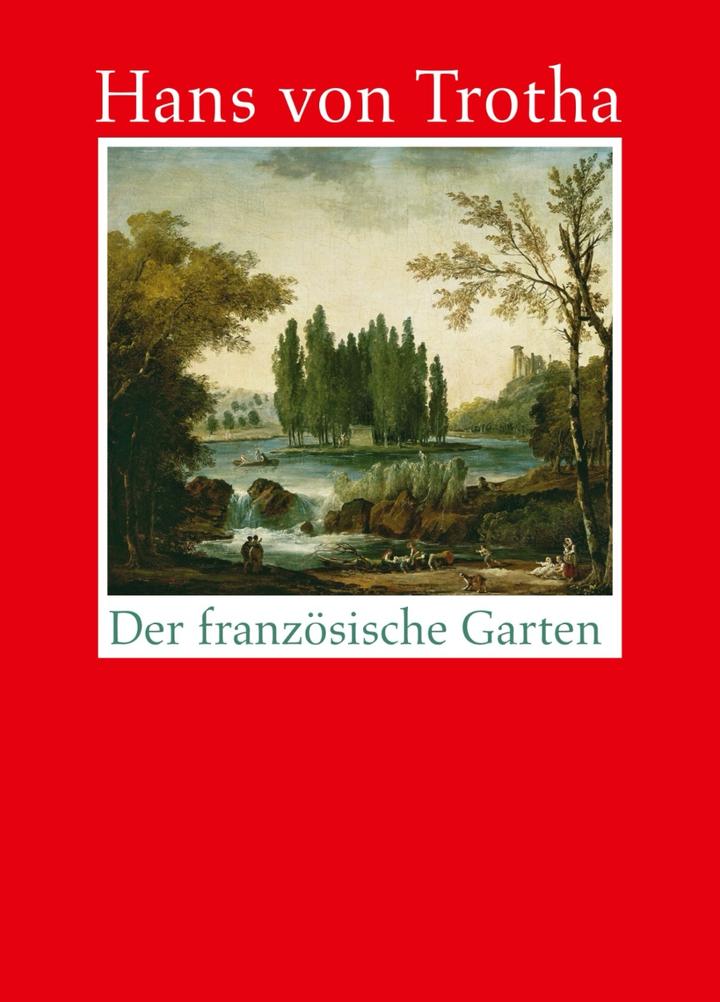
Der Französische Garten (Affiliate-Link)
Die Ästhetikbeflissenen der Romantik, sie wollten lieber in die freie Natur als in einen kuratierten abgegrenzten Pflanzenraum, wie ihn der Garten darstellt in der damals in Kontinentaleuropa noch dominierenden französischen oder Leibniz'schen Form. So behaupten es zumindest die Absichtsbekundungen und Pamphlete der Romantiker, vor allem der deutschen, auf der stetigen Suche nach dem Gefühl des Erhabenen. Doch es wurden selbstverständlich auch im späten 18. und 19. Jahrhundert Gärten und Parks angelegt. Der Berliner Historiker und Philosoph der Gartenbaukunst, Hans von Trotha, hat sie alle besucht und versucht, „Im Garten der Romantik“ Zusammenhänge und Differenzen, Kontinuitäten und Brüche zu finden – zwischen Zeiten, aber auch zwischen Ländern und Kulturen, ausgehend von den deutschen Gärten der Romantik. Er findet, ähnlich Olivia Laing, eine Historie der Zivilisation, die nicht immer idyllisch bukolisch war. Und doch ist es immer die sinnliche Anziehungskraft der Gärten, die solche Erkenntnis quer durch alle Kulturen und Zeiten möglich machte. Der Begriff des Erhabenen entstand eben nicht in der widrigen Natur, sondern im Garten.
„Der Französische Garten“ gibt dagegen eine kleine Zivilisationskunde der französischen Gärten: Plural, denn es gibt eine Vielfalt, die vom Kernklischee des französischen Gartens (Symmetrie, Ordnung, Einhegung, Kontrolle, Klarheit, Sichtachsen) abweicht, oder sie kunstvoll beugt und variiert – beinahe bis hin zum Antagonisten, dem Englischen Garten. Hans von Trotha spaziert durch die Gärten in und um Paris und erzählt en passant die Geschichte der europäischen Gartenarchitektur und der Gesellschaftspolitik, die mit und durch die Gärten betrieben wurde und wird. Von wem, für wen, warum und in welcher Form: Gärten sind immer ein Spiegel ihrer Zeit und der Gesellschaft. Sie haben aber durch ihre Langlebigkeit auch einen dynamischen Charakter. Das höchst erbauliche und informative Büchlein lädt ein, sich diese Geschichte – und was von ihr übrig blieb – einmal näher anzusehen, am besten vor Ort. Paris ist nicht weit.