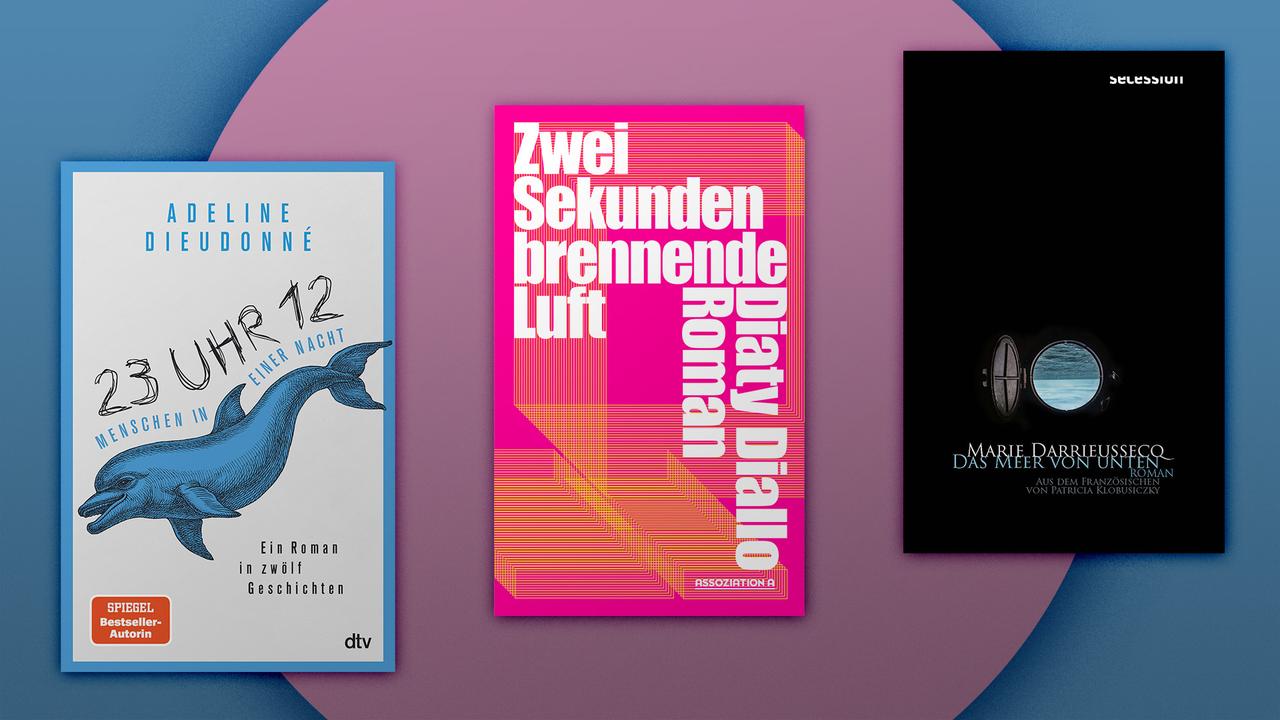Im Berliner Studio von Apple Music. Foto: Thaddeus Herrmann
Vor zehn Jahren startete Apple das hauseigene Musikstreaming. Seitdem hat sich Apple Music zu einem wichtigen Player in diesem Geschäft entwickelt. Von Anfang an ging es bei Apple aber nicht nur um das Streaming per se: Mit eigenem Radiosender, Musikvideos und weiteren Angeboten sollte Alleinstellung und Mehrwert den Dienst für Kund:innen attraktiv machen. Mittlerweile gibt es auch vermehrt Angebote für den deutschsprachigen Raum. Ist das relevant oder versendet sich der multimediale Content?
Wie bei so vielen Dingen war Apple ein bisschen spät dran, als mit Apple Music im Juni 2015 der eigene Musikstreaming-Dienst online ging. Mit iTunes hatte man sich in Cupertino ein eigenes Imperium aufgebaut, es wurde gechillt. Und übersehen, dass das Kaufen von MP3s nicht mehr dem Zeitgeist entsprach. Festplatten und iPods mit Dateien „vollzumüllen“, war von gestern. Einfach hören, also streamen, vielleicht mal ein paar Alben offline speichern, war die Devise. Also shoppte man sich Beats. Das Kopfhörer-Geschäft von Dr. Dre brachte Know-how für die eigene Audio-Abteilung, vor allem aber zwei Dinge nach Cupertino: den Beats-Streaming-Dienst mit Software, Apps, Lizenzen und Content einerseits, und andererseits mit dem Management weitere Kontakte in die Musikindustrie. Nach initialer Aufregung zeigte sich Apple Music als verlässlicher Streaming-Dienst. Die einen hassten die App, die anderen kamen gut damit klar, die einen vermissten dies, die anderen feierten das – wie es eben so ist bei einem Service, den man bei unterschiedlichen Anbieter:innen buchen kann.
Aber das 2015 fast schon traditionell wirkende Streaming war Apple nicht genug. Von Anfang an wollte man Mehrwert bieten. Mit Playlists, die von Menschen und nicht von Algorithmen zusammengestellt und gepflegt wurden, aber auch mit Beats 1 (heute Apple Music 1), einem 24/7-Radiosender mit echten Menschen als Moderator:innen. Kostenlos zu hören, also auch für die, die das Streaming auch weiterhin nicht bei Apple buchen wollten. Das war schon frischwindig und auch durchaus überzeugend. L.A. als Stützpunkt für den Mainstream mit Zane Lowe, New York als HipHop-Metropole mit Ebro Darden, London für alles dazwischen, mit u.a. Matt Wilkinson, den dieses Magazin 2019 vor Ort besuchte. Dazu kamen Sendungen, die von Künstler:innen moderiert werden. Einige davon schwimmen souverän auf der Radio-Welle (Elton John, nach wie vor!), andere verstehen ihre Shows eher als Mixtape und halten mit den Geschichten, die sie erzählen könnten, hinter den Berg (Brian Eno). Und wieder andere, zum Beispiel ganz aktuell Max Richter, leiten uns mit leiser Stimme und guter Selection durch musikalische Themen und Assoziationen. Und: Tim Sweeney ist auch immer noch dabei – und stabil.
Der Stream der Überforderung
Seit einigen Jahren arbeitet Apple verstärkt daran, dieses Radioangebot auszubauen. Sechs Sender laufen aktuell nebenher: neben Apple Music 1 auch noch Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill. Studios gibt es mittlerweile auch in Nashville, Tokyo, Paris und Berlin, weitere sollen folgen. Üppig produzierte Videos bzw. Videointerviews ergänzen das Angebot – auch deutschsprachig.
So ein Angebot ist natürlich kein Hexenwerk. Bei NTS hat jeder Grashalm seine eigene Residency, wenn sein Tänzeln im Wind mit einem originalen WW2-Mikro aufgenommen wurde. Refuge Worldwide, Cashmere, Rovr senden Show um Show. Entweder man findet seine Nische oder es versendet sich. Und genau das scheint bei Apple der Fall zu sein. Das Angebot ist mächtig, oft aber undurchschaubar. Wann welche Show läuft, lässt sich zwar recherchieren, wird aber nicht klar oder zumindest nicht klar genug kommuniziert. Dass man sich in Cupertino offenbar nie darüber Gedanken gemacht hat, einen klar strukturierten und über Zeitzonen hinweg transparenten Sendeplan zugänglich zu machen, ist schon absurd. Widerspricht einerseits dem Mantra des Unternehmens, dass Musik ein integraler Bestandteil des eigenen Selbstverständnisses sei und ja ohnehin alle Produkte das Leben der Menschen besser machen sollen – und legt andererseits die Schlussfolgerung nahe, dass man eben doch lieber ein Abo verkaufen möchte, mit dem es auch Zugriff auf das Archiv zum Nachhören gibt. Fair enough, aber selbst dann verschwindet Content einfach im App-Gewusel – und wird schließlich vergessen. Die Trennung zwischen Show, Playlist, Interview und DJ-Set ist unscharf, die Präsentation in der App folgt keinem nachvollziehbarem Muster. Schade eigentlich. Ein Seepferdchen-Abzeichen reicht nicht, um diesen Radio-Ozean zu durchqueren.

Oliver Schusser (links) und Aria Nejati (rechts). Foto: Apple
Berlin calling
Vielleicht ist das aber auch alles nur der Wahrnehmung des Autoren geschuldet. Vielleicht erträgt er einfach den zeitgenössischen Diskurs der popkulturellen Gegenwart nicht, will nichts wissen über vermeintliche Shooting Stars einer untergehenden Welt.
Neulich, da trafen sich ein paar Journalist:innen im Berliner Keller von Apple Music, um, naja, zu hören, was es so zu berichten gibt zum 10-jährigen Jubiläum. Oliver Schusser, Apples Music-Chef, war da und Aria Nejati, der „Head of HipHop“ bei Apple Deutschland, der mit seinem Talkshow-Format „HYPE(D) Zeitgeist“ (da hatte eine Person im Marketing eine richtig gute Zeit bei der Namensfindung) ordentlich für Furore sorgt. Der sagt Sätze wie: „Unsere Formate stehen für echten Musikjournalismus und starke redaktionelle Arbeit. Formate, die Künstler groß machen, Trends setzen und die Kultur hier vor Ort prägen.“
Stimmt halt nicht so richtig.
Denn was auffällt – national wie international –, ist, dass bei Apple Music 1 gerne gekuschelt wird. Es ist mehr als begrüßenswert, dass Künstler:innen in länglichen Interviews porträtiert werden. Und dass die Moderator:innen zuhören. Zuhören ist eine große Tugend, aber eben nicht alles. Distanz und vor allem eigene Fragen, nicht das Entlanghangeln am Infozettel zur neuen Veröffentlichung, macht die Qualität aus. Freundschaftlicher Umgang ist kein Problem, regelmäßiges Rekurrieren auf die gute und lange Bekanntschaft hingegen lässt die journalistische Perspektive unscharf werden. Ein solcher Interviewstil zahlt ein auf den Halbsatz „Formate, die Künstler groß machen“, bietet sonst aber kaum Mehrwert. Das kann sich alles fangen, alles besser werden. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich erst nach dem letzten Beat.
Oliver Schusser wiederum schaut aufs große Ganze: Mehr und gerechtere Vergütung (Abgrenzung zu Spotify), weniger manipulierte Streams (Abgrenzung zu Spotify) und Apple Music Classical (Abgrenzung zu Spotify). Das ist alles valide und bestimmt auch für die relevant, die Spotify den Rücken kehren, weil CEO Ek Geld aus den Unternehmen zieht und in Dronen-Entwicklung investiert. Der Mehrwert? Verpufft dennoch.
Vielleicht geht das gar nicht anders. Vielleicht gibt es wirklichen Mehrwert wirklich nur auf den Plattformen, die den vermeintlichen Mainstream von vornherein kategorisch ausklammern und bewusst nicht bedienen. Das ist schwierig genug. Denn Indies sind schon lange keine Indies mehr, und die überlebenswichtige Verzahnung mit den Streamern macht Kompromisse im Tagesgeschäft notwendig, an die vor wenigen Jahren noch nicht zu denken war – von der Kommunikation bis zu Veröffentlichungs-Strategien. Dass Apple das Mainstream-Game mitspielt, ist so logisch wie schade. Das Unternehmen könnte sich im Luxus des hauseigenen Radios alles leisten. Und folgt doch zum allergrößten Großteil den Mechanismen, die dafür verantwortlich sind, die all diejenigen, die das Radio seit jeher lieben, von ihren Medium der Wahl Schritt für Schritt entfremdet haben.
Zehn Jahre Apple Music hinterlassen gemischte Gefühle. Beim Streaming von Album X oder Song Y macht der Service alles richtig. Das ist aber auch keine Raketenwissenschaft. Bei der Etablierung des Radioprogramms aber – chance of a lifetime, wenn man ehrlich ist, fehlt die richtige Strategie: Sichtbarkeit, Mut zum Risiko, Bekenntnis zur Nische und der Stinkefinger in Richtung Establishment.