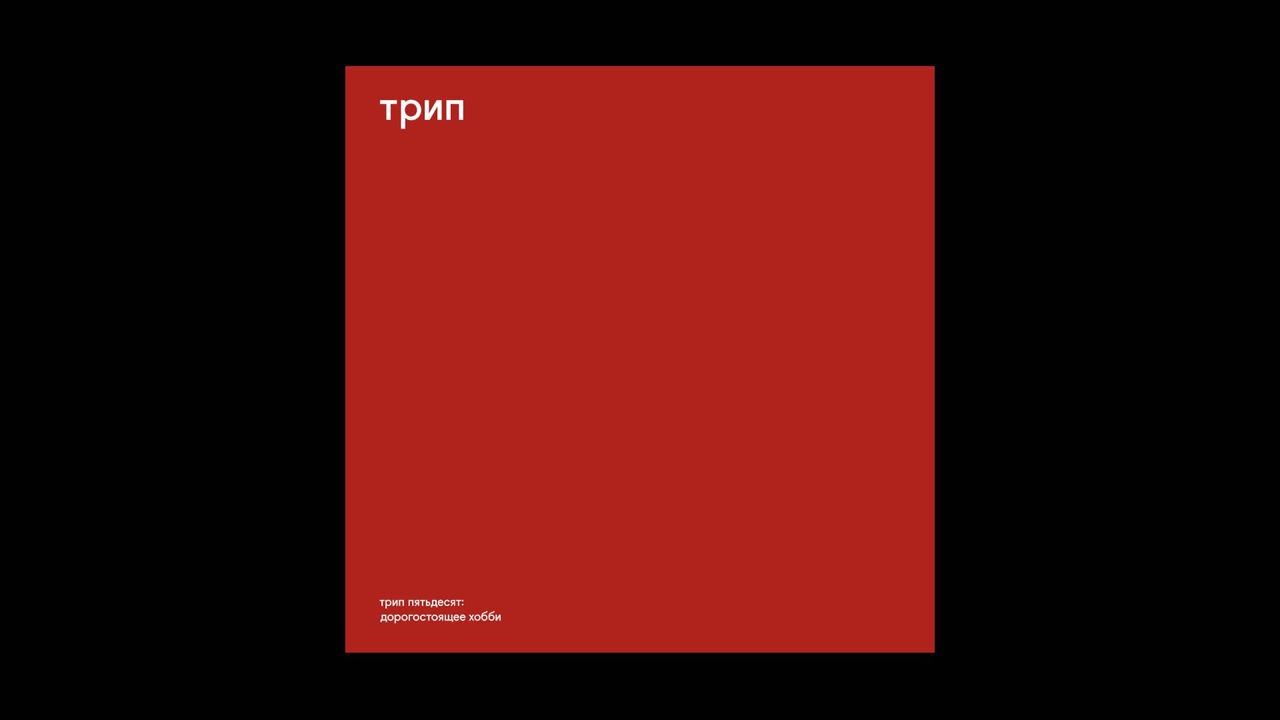Plattenkritik: Nada Surf – Moon Mirror (New West)Let there be Indierock
13.9.2024 • Sounds – Text: Jan-Peter Wulf
Nada Surf musizieren seit 30 Jahren und klingen auf ihrem neuen Album so, als seien sie maximal bei der Halbzeit angekommen.
Making out with people I hardly know or like
I can't believe what I do, late at night
I wanna know what it's like
On the inside of love
I'm standing at the gates
I see the beauty above
Mann, konnte ich mit diesen Zeilen relaten, in Zeiten, als ich selbst immer mal wieder an eben jenen Toren stand und mir dieses Ding genannt Liebe von außen anschauen musste. „Inside of Love“ ist auf meiner imaginären Herzschmerz- und Selbstmitleidsplaylist ziemlich weit vorne. Dabei ist der Hit von Nada Surf eigentlich gar nicht so repräsentativ für ihre Musik, die ich immer als wesentlich flotter und als urtypisch amerikanisch-indierockig empfunden habe. Als ich die Band ein einziges Mal live sah, war dies indes kein gängiges Konzert, sondern ein fantastisches Akustikset, performt in einer Dortmunder Kirche. Das ist fast zwei Jahrzehnte her, sehe ich gerade, und Nada Surf sind – damals erschien das schöne Album „The Proximity Effect“ nun sechs Alben weiter. Das Neue zum 30. Bandbestehensjahr haben sie „Moon Mirror“ genannt, es ist, um es kurz zu machen: unaufgeregt, eingängig. Als es fast schon ein bisschen zu sehr gleichförmig wird, obschon die Singles „Moon Mirror“ und „Losing“ schön und geradezu ideal für FluxFM radioeins zu sein scheinen, kommt mit „Intel and Dreams“ ordentlich Druck rein. Ebenso später bei „Open Seas“. Gut abgehangen ist anders. Erfreulich zu hören, dass die Combo ihren Drive, dabei sind Gründungsmitglieder Matthew Caws und Daniel Lorca mittlerweile Endfünfziger, unterwegs nicht eingebüßt hat, Lorca trägt sogar weiter tapfer seine Dreadlocks. Und auch die Romantik, die Nada Surf können, ist an Bord: Das Lied, bei dem auf den Konzerten atmosphärisches Licht von der Bühne leuchten und im Publikum möglicherweise geknutscht wird, ist „New Propeller“, bevor dann mit „Open Seas“, „X is You“ und „Give Me The Sun“ höchst munter weitergeschwoft wird. Man kann das Ganze, so wie es sich hier darlegt, als etwas kalkuliert interpretieren. Aber auch als musikalischen Ausdruck eines Stoizismus, den nicht nur das amerikanische Fanpublikum gut gebrauchen kann. Und ganz zum Schluss, mit „Floater“, geht die Indiesonne dann noch mal so richtig auf.